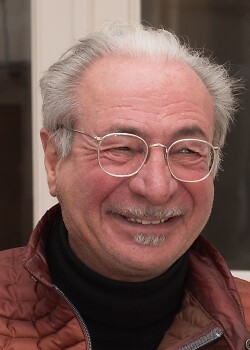Christi Himmelfahrt (29. Mai 2025)
1. Könige 8, 22-24.26-28
IntentionAusgehend vom alttestamentarischen Text und vom Kontext der Jerusalemer Tempeltradition wird in dieser Predigt der Bogen gespannt über die philosophisch-theologische Frage nach der Allgegenwart Gottes bis hin zur christologisch-ethischen Antwort in Jesus Christus.
PredigttextUnd Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach:
Herr, Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen;
der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet, und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage.
Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht,
meinem Vater David, zugesagt hast.
Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen?
Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich
nicht fassen - wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe?
Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, damit du hörest das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir.
Eine uralte Frage:"Wo wohnt Gott?"
Diese Frage, liebe Gemeinde, erscheint auf den ersten Blick sehr unbedarft.
"Wo wohnt Gott?"
So fragen gelegentlich unsere Kinder oder Enkelkinder und können uns Erwachsene damit ziemlich in Verlegenheit bringen.
In Verlegenheit bringen deshalb, weil die gängige Antwort darauf: "Gott wohnt im Himmel", eigentlich keine Antwort ist.
Die Kinder merken das ja auch und fragen prompt darauf: "Und wo ist der Himmel?"
Heute am Himmelfahrtstag sollten wir die Gelegenheit und den Anlass einmal nutzen, um uns auf diese scheinbar so naive Frage einzulassen und sie zu bedenken.
"Wo wohnt Gott?"
Das ist eine der tiefgründigsten und ältesten Fragen der Menschheit überhaupt.
Immer wieder haben Menschen versucht, Orte zu finden oder zu erfinden, wo Gott wohnt, wo Gott gegenwärtig ist.
Von den Höhlen und Naturkultorten der Steinzeitmenschen, über die Tempelbauten der Ägypter, Griechen und Römer bis hin zu den Kirchen und Kathedralen der Christenheit – quer durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht sich diese Frage und dieses Verlangen: Gott einen Wohnort zu geben, Gott dingfest zu machen auf der Erde, Gott gegenwärtig sein zu lassen, in einem Heiligtum, in einem Tempel, in einer Kirche.
Der Tempel von Jerusalem und seine besondere BedeutungAuch Salomo, Israels großer König, hatte das Verlangen, Gott auf Erden ein Heiligtum zu schaffen.
Und er baute, in Übereinstimmung mit seinem Volk, einen Tempel, der für seine Pracht berühmt wurde.
Am Tag der feierlichen Einweihung nun spricht er die Worte, die wir als Predigttext gehört haben.
Es sind feierliche, erhabenen Worte.
Sie atmen etwas von der Gegenwart Gottes.
Und dennoch beinhalten sie eine Selbstkritik, eine kritische Bemerkung zu dem Verlangen, Gott an einem Ort, in einem Tempel dingfest machen zu wollen.
"Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen?
Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen.
Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe?"
So sprach Salomo. Und er wäre nicht der weise und kluge König gewesen, als der er ja bis heute bekannt ist, wenn er so nicht geredet hätte.
Und sein Volk, das Volk Israel, wäre nicht das von Gott erwählte Volk gewesen, als das es ja bis heute gilt, wenn es diese Worte nicht verstanden hätte.
Der König hinterfragte also das Ansinnen, Gott einen Ort auf Erden zu geben.
Die Allgegenwart Gottes
Gott kann man nämlich nicht an einen Ort bannen, weder im Diesseits noch im Jenseits.
Gott ist allgegenwärtig und allmächtig.
Er ist größer als unsere Größenordnungen es ermessen können.
Er ist kleiner als unsere Mikroskope es erkennen können.
Er ist weiter als wir Menschen, mit unseren Dimensionen, es je erfassen können.
"Gott ist dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann", so hat es einmal der Theologe Anselm von Canterbury ausgedrückt.
"Der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen", so bringt es König Salomo auf den Punkt.
Und dennoch baute er diesen Tempel.
Dennoch, trotz aller Kritik, im Bewusstsein, Gott nicht an einem Ort fassen zu können, war dieses Verlangen da:
Das Verlangen, Gott einen Ort zu geben, einen Ort, wo er gegenwärtig ist.
Einerseits das Verlangen nach Gottes Nähe, das Verlangen des Volkes nach einem Heiligtum – andererseits das Bewusstsein, dass man Gott nicht festlegen und nicht Dingfest machen kann.
Das war eine Herausforderung, und Salomo hat sich ihr gestellt.
Salomo war für seine Weisheit und Klugheit bekannt, er entwickelte im Blick auf die Bedeutung des Tempels eine Idee. Er fand eine Antwort, die jedenfalls ein Stück weiter führt..
Ein Ort der TranszendenzFür Salomo war nicht die volle Präsenz Gottes auf der Erde wichtig und nötig.
Nicht die Gewissheit, Gottes Nähe voll und ganz und nur an einem Ort der Welt zu haben, sondern die Verbindung zu ihm war für ihn entscheidend.
Einen Ort zu haben, von dem aus es eine Verbindung zu Gott gibt, wo man Kontakt zu ihm aufnehmen kann.
Und der Tempel in Jerusalem war für die Israeliten genau dieser Ort der Verbindung zwischen Gott und der Welt.
Der Tempel war für sie der Schemel Gottes, der Ort, an dem Gottes Füße die Erde berührten.
Man kann nun sagen: Das ist auch ein wenig betulich, diese Vorstellung von Gott als einem Großvater, der einen Schemel braucht. Andererseits ist es aber auch genial.
Denn der Gedanke, dass es eine Verbindung zwischen Gott und der Welt, eine Verbindung zwischen dem Jenseits und dem Diesseits gibt, dieser Gedanke ist nachvollziehbar.
Diese Verbindung ist an einem Ort, an einer ganz bestimmten Stelle, möglich. Diese Behauptung ist nützlich zumindest für den, der im Besitz dieses Ortes ist.
Für Salomo waren der Berg Zion in Jerusalem und der auf ihm erbaute Tempel dieser Ort. Und an diesem Ort gab es eine Stelle, an der die Verbindung Gottes mit der Welt, wie durch einen Kanal hergestellt und möglich schien.
Diese Stelle war das Allerheiligste, ein kleiner Raum im hintersten Teil des Tempels.
Darin stand die Bundeslade. Dieser Raum war von einem schweren Vorhang bedeckt. Dort war es stockdunkel und niemand durfte diesen Ort betreten.
Nur dem Hohenpriester war es einmal im Jahr erlaubt, am großen Versöhnungstag hineinzutreten und Gott um Versöhnung für das ganze Volk zu bitten.
Gott wohnte nicht in diesem Raum. Aber man konnte in diesem Raum Kontakt mit ihm aufnehmen.
Es gab eine Verbindung, eine Vermittlung zu Gott.
Das war wichtig, und das ist für viele Menschen wichtig bis zum heutigen Tag.
Nicht umsonst gibt es bei unseren katholischen Geschwistern die Vorstellung, dass die Verbindung zu Gott durch den Papst garantiert ist.
„Pontifex“ heißt der päpstliche Ehrentitel. Pontifex bedeutet Brückenmacher oder Brückenbauer hinüber in die göttliche Dimension.
Deutlich wird darin das Bedürfnis nach einer Vermittlung zu Gott.
Dieses Bedürfnis verbindet uns Christen miteinander über die Konfessionen und Nationen hinweg.
Und dieses Bedürfnis wurde schließlich durch Gott selbst erfüllt. Er sandte uns seinen Sohn Jesus Christus.
Jesu Christus als der göttliche MenschChristinnen und Christen glauben an Christus. Er hat den Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen und den Zugang zu Gott freigemacht.
"Jesus aber schrie laut und verschied.
Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus." (Mt 27, 50f.)
So heißt es bei der Kreuzigung Jesu im Matthäusevangelium.
Jesus hat den Vorhang vor dem Allerheiligsten durch seinen Tod für uns zerrissen.
Er hat uns Zugang und Verbindung zu Gott verschafft.
Durch ihn können wir Kontakt zu Gott aufnehmen.
Wir haben deutliche Spuren zu seiner Person. Die Evangelien geben Zeugnis davon, wie er gelebt hat, was er gesagt und getan hat.
Gerade durch sein Tun und Handeln hat er uns einen Gott gezeigt, der nicht im fernen Himmel sitzt, sondern der den Menschen nahekommen will, der sich den Menschen zuwendet und sie liebt.
Seitdem Jesus auf der Welt wirkte, heißt die Antwort auf die Frage "Wo wohnt Gott?" "Er wohnt bei den Menschen."
Er wohnt zwar nicht nur bei den Menschen, aber er will auch nicht ohne sie sein.
Durch Jesus ist Gott mit uns in eine sichtbare Verbindung getreten.
Durch Jesus hat er sich uns gezeigt.
Er hat sich gezeigt als ein Mensch, der andere Menschen nicht verletzt, sondern sie geheilt hat.
Er hat sich gezeigt als ein Mann, der andere Männer nicht beherrschen wollte. Im Gegenteil, er hat Frieden gestiftet unter ihnen, er hat Frauen den Männern gleich geachtet.
Von Jesus ging so viel Kraft und Liebe und Zuwendung aus, dass diejenigen, die ihm begegnet sind, den Himmel auf Erden erfahren haben.
Und überall da, liebe Gemeinde, wo in seiner Nachfolge Menschen so miteinander leben, wo sie einander nicht verletzen, sondern heilen, wo sie unter einander Frieden stiften, sich einander zuwenden und lieben, überall da kann auch heute noch ein Stück Himmel auf Erden erfahren werden.
Der Himmel beginnt nicht erst im Jenseits oder am Ende aller Tage.
Der Himmel beginnt im Hier und Jetzt.
Und Gott wohnt nicht nur im Himmel.
Er wohnt auch bei den Menschen, bei den Menschen, die ihr Leben und Tun an Jesus Christus ausrichten.
Die Verbindung zu Gott und zu dem, was wir den Himmel nennen, entsteht weder durch einen Kult-Ort noch durch eine Kult-Person.
Die Verbindung zu Gott und zu dem, was wir den Himmel nennen, entsteht durch ein Leben, das die Liebe kennt,
sie entsteht durch einen Glauben, der auf Gott vertraut,.
Mit Gott verbindet uns die Hoffnung auf Jesus Christus. Er ist auferstanden und so der Brückenbauer zur Ewigkeit.
Amen.
Predigt zum Herunterladen: Download starten (PDF-Format)